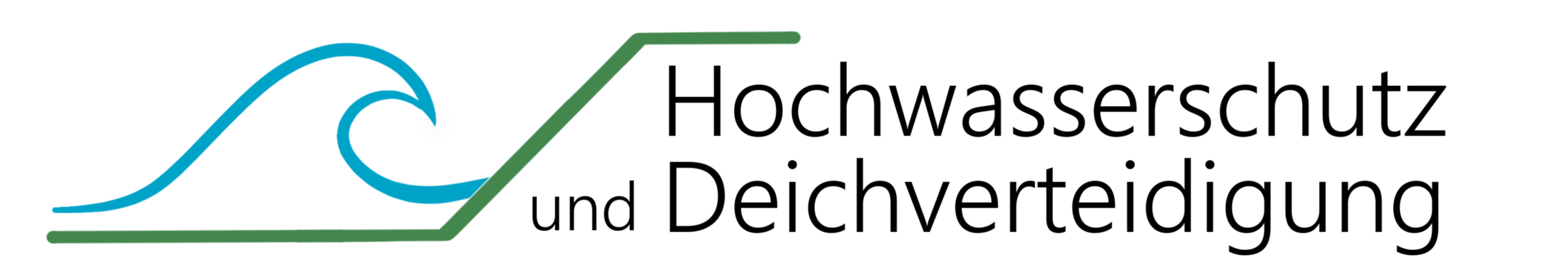Haben wir alles falsch gemacht? Nein – wir hatten es nicht besser gewusst! – von Dr. Geert Lehmann
Zeit: 17. August bis 31. August 2002
Ort: „Lauenburger Elbvorland“, der Elbedeich, rechtes Ufer, Flusskilometer 563 – 569
Kräfte: ca. 800 Helfer und Helferinnen der sieben THW Ortsverbände in Hamburg, zuzüglich 1.200 Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr
Ziel: Verhinderung eines Deichbruchs, ein Altdeich im „übelsten“ Zustand, der Neubau des Deiches ist bereits geplant, es gibt eine Bodenuntersuchung im Bauwagen vor Ort, in der Zusammensetzung inhomogen, auf 400m Länge auf einer Torfschicht stehend…
Lage: am 18. August 2002 hatte der Landkreis Herzogtum Lauenburg Katastrophenalarm ausgelöst. Es wird ein Hochwasser erwartet, dass die Höhe des vorhandenen Deiches übersteigt. Die aus Hamburg eintreffenden THW Kräfte übernehmen von der örtlichen Feuerwehr, die zuvor die knapp 7 Kilometer Deich auf Weisung sowohl mit einem Sandsackdamm erhöht hatte als auch die Außenböschung des Deiches komplett mit einer wasserdichten Folie belegte, in dem Versuch, das Wasser der heranrollenden Flutwelle zu hindern, in den Deichkörper einzudringen …
Diese wasserdichte Folie außendeichs wurde mit Sandsäcken beschwert. Bereits auf dem rechten Foto oben sieht man „Blähungen“, Blasenbildung durch Wind, der unter die Folie drückt. Gleichzeitig ist die Folie ständig durch Treibgut gefährdet, geschlitzt zu werden.
Alsbald setzte deshalb ein „Reparaturbetrieb“ ein: Boote des THW kontrollierten und sicherten auf Treibsel und Treibgut. Taucher der Schleswig Holsteiner Polizei kontrollierten die Folie unterwasser auf Defekte, reparierten und legten Sandsäcke neu, da die eintreffende Flutwelle bei einer Steilheit der Außenböschung von 1 : 2 die Sandsäcke bei zunehmendem Auftrieb unter Wasser wie geschmiert gen Fußpunkt rutschen ließen.
Geradezu makaber war der Versuch, durch Tape einzelne Defekte und Schnitte der Folie Zentimeter für Zentimeter abzudichten.

Nur ein Jahr später (27.11.2003) habe ich dann in einem Vortrag in München „lessons learnt“ die These und die Ergebnisse der Studie der Uni Karlsruhe, Prof. Dr. Josef Brauns vorgetragen und vertreten:
„Keine Folien außendeichs!“
„Der Deichkörper wird in voller Höhe mit Wasser belastet und in gleicher Weise von Wasser durchströmt wie ohne Folienabdeckung.“

Es ging ein Raunen durch den Veranstaltungssaal. Einige, die offenbar auch ihre Daseinsberechtigung am Verlegen von Folien außendeichs und am Einsatz von Tauchern zur Sicherung derselben knüpften, versuchten zu widersprechen. In meinen Unterrichten für die Führungskräfte des THW an den THW Ausbildungszentren und in den THW Ortsverbänden zum Thema „Hochwasserschutz und Deichverteidigung“ unterrichte ich dies bis heute und genauso: Keine Folien außendeichs!
Lessons learnt? Ja – und wir hatten den Deich vor 20 Jahren gehalten, trotz der Folien!